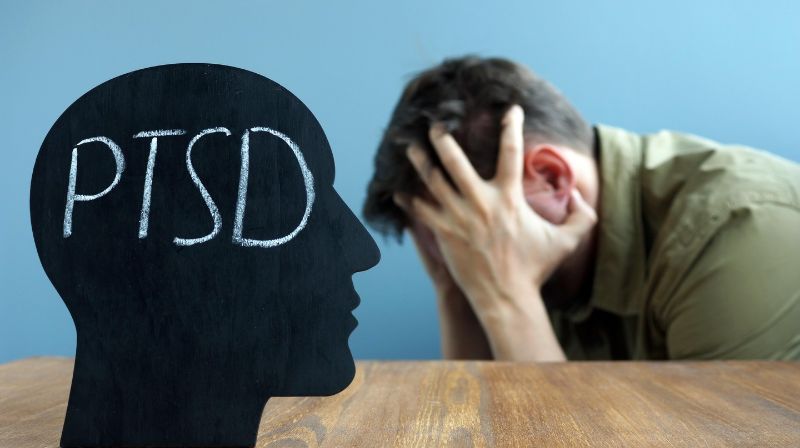Warum haben wir nicht alle posttraumatische Belastungsstörungen?
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine schwächende Erkrankung, die nach traumatischen Erlebnissen auftritt. Obwohl viele Menschen ein Trauma erleben, entwickeln nur etwa 25-35 % eine PTBS. Das Verständnis der Faktoren, die bestimmte Personen anfälliger machen, ist sowohl für die Prävention als auch für die Behandlung entscheidend.
Eine neue Studie unter der Leitung von Carmen Sandi und Simone Astori an der EPFL zeigt nun, wie die Entwicklung von PTBS durch Glukokortikoide beeinflusst wird, Hormone, die unser Körper als Reaktion auf Stress ausschüttet, wie zum Beispiel Kortisol. Die Arbeit gibt wichtige Einblicke in die Verhaltens- und biologischen Merkmale, die mit der Anfälligkeit für PTBS verbunden sind.
«Es gibt beträchtliche Unterschiede in der Menge an Glukokortikoiden, die Menschen bei Stress in den Blutkreislauf abgeben», sagt Carmen Sandi, «niedrige Glukokortikoidspiegel werden häufig bei PTBS-Patienten nach einer Traumaexposition beobachtet und wurden ursprünglich als Folge der Traumaexposition vermutet.»
Sie fährt fort: «Die Möglichkeit, dass es sich hierbei um ein Merkmal handelt, das einen bereits bestehenden Risikofaktor für PTBS darstellt, ist seit vielen Jahren eine offene Frage, deren Beantwortung jedoch eine Herausforderung darstellt, da es schwierig ist, biologische Messwerte vor der Traumaexposition zu erheben und Zugang zu relevanten Tiermodellen zu haben, in denen die kausale Rolle dieser Merkmale untersucht werden kann.»
Um zu untersuchen, wie eine verminderte hormonelle Reaktion auf Stress mit PTBS-Symptomen zusammenhängen könnte, verwendeten die Forschenden ein genetisch ausgewähltes Rattenmodell, das Menschen mit einer abgestumpften Reaktion auf Cortisol nachahmt. Dazu verwendete das Team MRT-Scans, um das Volumen verschiedener Gehirnregionen zu messen, trainierte die Ratten, einen Reiz mit Angst zu assoziieren, zeichnete ihre Schlafmuster auf und mass ihre Gehirnaktivität.
Durch die Kombination dieser Methoden entdeckten die Forschenden, dass eine abgeschwächte Reaktion auf Glukokortikoide zu einer «korrelierten Mehrfachreaktion» führt, die eine beeinträchtigte Furchtauslöschung (bei Männern), ein verringertes Hippocampus-Volumen und Schlafstörungen mit schnellen Augenbewegungen umfasst.
Zur Erklärung der Begriffe: Furchtlöschung ist ein Prozess, durch den eine konditionierte Furchtreaktion mit der Zeit abnimmt; Probleme mit der Furchtlöschung sind ein Kennzeichen der PTSD. Die schnelle Augenbewegung ist entscheidend für die Gedächtniskonsolidierung, und Störungen dieses Schlafmusters werden seit langem mit PTBS in Verbindung gebracht.
Doch damit nicht genug: Die Forschenden behandelten die Ratten mit dem Äquivalent einer menschlichen kognitiven und Verhaltenstherapie, um ihre erlernten Ängste zu reduzieren. Danach verabreichten sie den Ratten Kortikosteron. In der Folge gingen sowohl die übermässige Angst als auch die Störungen des Rapid-Eye-Movement-Schlafs zurück. Und nicht nur das: Auch der erhöhte Spiegel des stressbedingten Neurotransmitters Noradrenalin im Gehirn normalisierte sich wieder.
«Unsere Studie liefert kausale Beweise für eine direkte Beteiligung einer niedrigen Glukokortikoidreaktion an der Entwicklung der PTBS-Symptomatik nach traumatischen Erlebnissen, d. h. einer gestörten Furchtauslöschung», sagt Carmen Sandi. «Ausserdem zeigt sie, dass niedrige Glukokortikoide kausal an der Bestimmung anderer Risikofaktoren und Symptome beteiligt sind, die bisher nur unabhängig voneinander mit PTBS in Verbindung gebracht wurden.»
Silvia Monari, die Erstautorin der Studie, fügt hinzu: «Kurz gesagt, wir präsentieren mechanistische Beweise – die bisher fehlten –, dass niedrige Glukokortikoide wie Cortisol beim Menschen eine Bedingung für eine kausale Prädisposition für alle bisherigen Anfälligkeitsfaktoren für die Entwicklung von PTBS sind und kausal an Defiziten bei der Löschung traumatischer Erinnerungen beteiligt sind.»