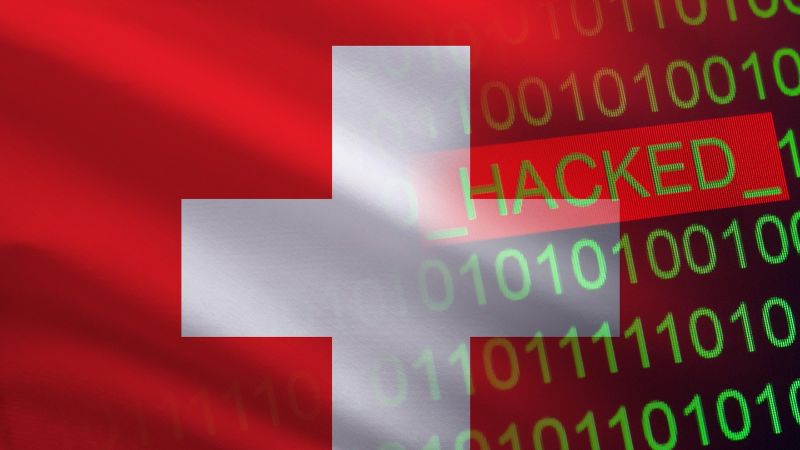Die Schweiz und die KI: klein aber oho
Auf zum Stargate-Sturm. Präsident Trump und seine Regierung haben laut und deutlich ihre Absicht verkündet, das GenAI-Rennen anzuführen, und zwar durch umfangreiche Investitionen und einen industriegeführten Ansatz. Auf der anderen Seite des Globus hat China mit der Einführung von DeepSeek, einem GenAI-Modell, das genauso leistungsfähig ist wie seine amerikanischen Konkurrenten (ChatGPT, Claude, Gemini usw.), aber weniger Energie verbraucht und auf einem Open-Source-Ansatz basiert, grosse Wellen in den Nachrichten und auf den Finanzmärkten geschlagen. Und genau in der Mitte steht die Schweiz, ein winziger Fleck auf der Weltkarte. Kann sie mit ihren zahlreichen Spitzenplätzen in Innovationsrankings ihren Platz in GenAI einnehmen?
Die neu geschaffene amerikanische Tech-Allianz wird einen unbestreitbaren Einfluss auf die Innovation haben, wobei die führenden Tech-Unternehmen wahrscheinlich ihre eigene Agenda vorantreiben werden. Die Schweiz hat bisher einen nuancierteren Innovationsansatz verfolgt, indem sie die Anstrengungen des öffentlichen und des privaten Sektors kombiniert hat, um die Innovation auf ausgewogene und kooperative Weise zu fördern.
Der technologische Fortschritt wird von beiden Sektoren massgeblich unterstützt. Mit F&E-Ausgaben in Höhe von 3,3 % des BIP gehört die Schweiz zu den fünf führenden Ländern der Welt. Zwei Drittel dieser Ausgaben stammen aus dem Privatsektor. Weitere wichtige Beiträge kommen aus dem akademischen Bereich, in Form von Talentwachstum, Patenten und der Gründung von Start-ups. Diese Beiträge werden durch staatliche Initiativen wie den Schweizerischen Nationalfonds, der Stipendien an vielversprechende Forschende vergibt, Präsenz Schweiz, Swisstech und Switzerland Global Enterprise unterstützt, die allesamt Schweizer Start-ups auf der internationalen Bühne fördern.
Es wurden spezielle Einrichtungen geschaffen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und die Vision der digitalen Souveränität des Landes zu unterstützen. Die EPFL und die ETH Zürich arbeiten mit anderen Hochschulen zusammen, um ein wachsendes Netzwerk von über 200 KI-Expertinnen und -Experten auf nationaler Ebene zu nutzen. Ziel ist es, die durch die KI verursachten gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Eine ihrer Hauptaufgaben ist die Entwicklung von GenAI-Modellen wie Large Language Models (LLM) speziell für die Schweizer Gesellschaft, mit dem ehrgeizigen Ziel, eine sichere, vertrauenswürdige und transparente KI aufzubauen.
Ein LLM aus der Schweiz
«Wir arbeiten an einem Modell, das mehrsprachig, transparent und quelloffen ist und sich besser für unsere privaten und öffentlichen Institutionen in der Schweiz eignet», sagt Martin Jaggi, Professor für maschinelles Lernen an der EPFL und Mitglied des Lenkungsausschusses der Schweizer KI-Initiative: «Wenn man sich die aktuellen Modelle ansieht, sind sie meist auf Englisch trainiert. Nehmen wir Metas LLama, dessen Daten zu rund 90 % auf Englisch sind. Unser Modell wird derzeit in mehr als 1000 Sprachen trainiert.»
Neben der Mehrsprachigkeit liegt ein weiterer Aspekt, der die Swissness des Modells vermittelt, in seiner Vertrauenswürdigkeit und Transparenz. Die Schweizer KI-Initiative will transparent machen, wie die Daten verwendet und verarbeitet werden, und die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften in der Schweiz und in Europa sicherstellen. Auch die vollständige Offenlegung der Ein- und Ausschlussmerkmale von Daten ist ein wichtiges Ziel: «Die Modelle erben alle ihre Stärken und Schwächen von den Trainingsdaten, deshalb wollen wir dies sehr deutlich machen», sagt Jaggi.
Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Schweiz bei den Rechenkapazitäten für die wissenschaftliche Forschung weiterhin an der Spitze steht. Zu diesem Zweck hat das Swiss National Supercomputing Center «Alps» gebaut – einen Supercomputer, der derzeit auf Platz sieben der 500 leistungsstärksten Supercomputer weltweit steht und der zweitstärkste Supercomputer in Europa ist. Als öffentliches Gut steht Alps einer breiten Gemeinschaft von Forschenden in der Schweiz und darüber hinaus offen. Der Schweizer LLM wird ab diesem Sommer verfügbar sein und rund drei Millionen GPU-Stunden absolvieren.
Die Schweiz kann zwar nicht mit dem Investitions- und Rechenvolumen der USA konkurrieren, hat sich aber für Qualität statt Quantität entschieden: «Die Schweiz kann vielleicht nicht das rasante, gewinnorientierte Modell des Silicon Valley kopieren, aber muss sie das wirklich? Ihr werteorientierter Innovationsansatz steht im krassen Gegensatz zu den Strategien der USA und Chinas und bietet eine einzigartige Mischung aus Qualität, ethischer Rücksichtnahme und Zusammenarbeit», sagt Patrik Wermelinger, Chief Investment Promotion Officer von Global Switzerland Enterprise. Damit positioniert sich die Schweiz als eigenständiger und nachhaltiger Akteur auf der globalen Innovationsbühne: «Mit ihrem starken Fokus auf F&E, Rechenexzellenz und Talentförderung beschreitet die Schweiz einen Weg, der Innovation mit langfristigem gesellschaftlichem Nutzen verbindet», so Wermelinger.
Jaggi fügt hinzu: «Die Nachricht von DeepSeek ist ermutigend für uns hier in Europa. Es ist ein Zeichen dafür, dass man auch ohne die Mittel grosser multinationaler Unternehmen ein hochwertiges Modell produzieren kann.»
Bei der weltweiten Suche nach nachhaltigeren und integrativen Modellen des technologischen Fortschritts erweist sich die Schweiz als Leuchtturm der Möglichkeiten. Die schnelllebige Technologiebranche zeigt uns, dass sich alles von einer Minute auf die andere ändern kann – aber eines ist sicher: Die langjährige Innovationsgeschichte der Schweiz ist noch lange nicht zu Ende, und ihr globaler Einfluss wird weiter wachsen.
Nation der Innovation
- Die Schweiz ist seit 14 Jahren in Folge auf Platz 1 des Global Innovation Index.
- Sowohl der INSEAD Talent Competitiveness Index als auch das IMD Talent Ranking positionieren die Schweiz auf Platz 1, was die Entwicklung, Anwerbung und Bindung von talentierten Arbeitskräften angeht.
- 3 % der Schweizer Bevölkerung haben einen Doktortitel (im Vergleich zu durchschnittlich 1 % in anderen Ländern).
- Die Schweiz hat die höchste Anzahl an registrierten Patenten pro Kopf in Europa.
- Die Schweiz hat die höchste Anzahl an KI-Patenten pro Kopf der Bevölkerung weltweit.
Einbindung der Öffentlichkeit: das Modell der Bürgerversammlung
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die KI langsam aber sicher Einzug in unser tägliches Leben hält. Während sie in schwindelerregender Geschwindigkeit Fortschritte macht, wirft ihr Einfluss viele wichtige Fragen auf. Wie können wir sicherstellen, dass die Entwicklung der KI mit den Werten und Bedürfnissen der Gesellschaft in Einklang steht?
Die Antwort liegt in einem vielschichtigen Ansatz, der Vorschriften, ethische Leitlinien und Forschung umfasst. Entscheidend ist, dass die Perspektiven, Sorgen und Hoffnungen der Bürgerinnen und Bürger verstanden werden, um die Entwicklung der KI zu fördern und zu steuern. In diesem Sinne hat das EPFL AI Center ein Pilotprojekt initiiert, um im Rahmen einer viertägigen Versammlung einen direkten Dialog mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Romandie zu eröffnen. Der Rekrutierungsprozess einer repräsentativen Gruppe von 40 Personen wird in Kürze beginnen. Das EPFL AI Center hofft, das Modell der Bürgerversammlung über die Romandie hinaus ausweiten zu können.
Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger stehen der KI nach wie vor zurückhaltend gegenüber. Der Global AI Monitor von Ipsos Mori zeigt, dass die Skepsis hier grösser ist als in anderen europäischen Ländern - nur 39 % der Schweizer Befragten sehen die KI als eine positive Kraft, verglichen mit 41 % in Europa und 57 % weltweit. Die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen und ihre Perspektiven in die politische Entscheidungsfindung in der Schweiz einzubeziehen, ist von grösster Bedeutung. Zu diesem Zweck hat das EPFL AI Center eine bahnbrechende Initiative gestartet: Die erste Bürgerversammlung der Schweiz zum Thema KI. Inspiriert von ähnlichen erfolgreichen Versammlungen in Schottland und Belgien, wird diese von der Stiftung Mercator unterstützte Initiative eine repräsentative Auswahl der Bevölkerung der Romandie zusammenbringen, um die Chancen und Risiken von KI zu diskutieren. Der Prozess umfasst Informationsveranstaltungen, Workshops und Diskussionen, die in einen Bericht münden, der öffentlich zugänglich gemacht wird.
«Unsere Vision ist es, dies als jährliche Veranstaltung zu etablieren, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger gehört werden und sich in der Art und Weise widerspiegeln, wie Forschende und politische Entscheidungsträger die KI in Echtzeit weiterentwickeln», sagt Marcel Salathé, akademischer Co-Direktor des EPFL AI Center.
Das Ziel? Es geht um mehr als nur darum, die Öffentlichkeit über KI zu informieren. «Wir wollen verstehen, was die Öffentlichkeit über KI denkt, und ihre Erkenntnisse in unsere Forschung und Entwicklung einfliessen lassen», so Salathé.
Ein zweiseitiges Gespräch
Für das EPFL AI Center sollte die öffentliche Auseinandersetzung mit KI ein ständiges Thema sein. Der Wissenstransfer muss in beide Richtungen gehen: Die Forschenden bilden die Öffentlichkeit aus und die Öffentlichkeit bietet wertvolle Perspektiven, die die Entwicklung der KI beeinflussen können. Gegenseitiger Respekt ist bei diesen Diskussionen entscheidend.
Jemma Venables, Programm-Managerin der Initiative, hat ein klares Ziel: «Der partizipative Ansatz der Schweiz im Bereich der KI könnte ein Beispiel für andere Länder sein und sicherstellen, dass künftige politische Massnahmen nicht nur die Interessen von Unternehmen oder Regierungen widerspiegeln, sondern auch die Bedürfnisse und Werte der Bürgerinnen und Bürger. Da sich die KI weiter entwickelt, müssen auch unsere Mechanismen dafür sorgen, dass sie – und diejenigen, die sie steuern – rechenschaftspflichtig, integrativ und vertrauenswürdig sind.