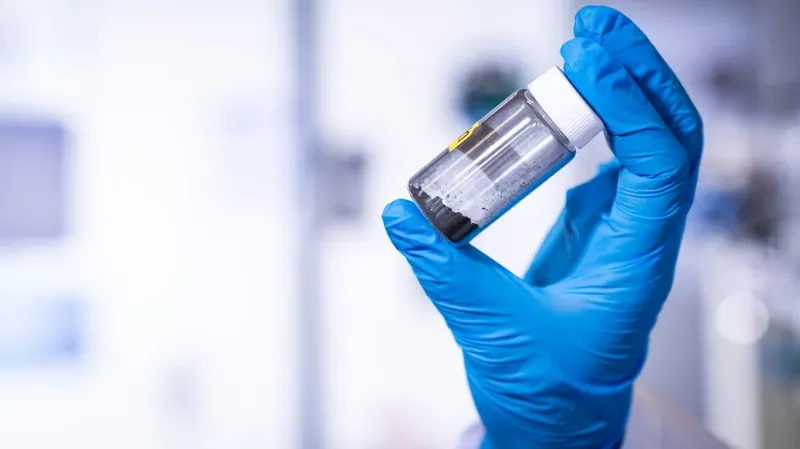Schneller zu grünem Wasserstoff
Sauer ist eine Herausforderung. Will man Wasserstoff per Elektrolyse herstellen und nutzt dafür einen kostengünstigen Katalysator wie Kobalt, so gelingt der Prozess schlechter, wenn das Milieu sauer ist – und leichter, wenn man im Alkalischen arbeitet. Den Grund dafür haben Forschende am Paul Scherrer Institut PSI nun gefunden: Die Oberfläche des Katalysators verändert sich mit dem pH-Wert der Umgebung. Die Studie erschien im Fachblatt Nature Chemistry und liefert wichtige Anhaltspunkte, um in Zukunft effizient und kostengünstig Wasserstoff für die Energiewende produzieren zu können.
Die einfachste und umweltfreundlichste Methode, um Wasserstoff herzustellen, ist die Elektrolyse: Wasser (H2O) wird mit elektrischem Strom in seine Bestandteile Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2 aufgespalten. Am positiven Pol, der Anode, entsteht Sauerstoff; am negativen Pol, der Kathode, Wasserstoff. Eine Wasserspaltung lässt sich sowohl im alkalischen Milieu (pH>7), im Sauren (pH<7) sowie im Neutralen (pH=7) durchführen. Unterschiedliche Typen von Elektrolyseuren arbeiten bei verschiedenen pH-Werten, also verschiedenen Milieus.
Bei der Spaltung von Wasser ist die Bildung von Sauerstoff der Schritt, der am meisten Energie benötigt, quasi der Flaschenhals der Reaktion. Um ihn effizient und kostengünstig möglich zu machen, setzt man Katalysatoren ein, beispielsweise das Metall Kobalt. Die Elektrolyse mit Kobalt funktioniert allerdings nur in einem alkalischen Milieu zufriedenstellend gut; der Grund dafür war bisher unbekannt.
Eine Forschungsgruppe am PSI-Zentrum für Energie- und Umweltwissenschaften hat die Ursache nun herausgefunden: Abhängig vom pH-Wert verändert der Katalysator seine Oberfläche. Im Sauren benötigen aktive Stellen, an denen Sauerstoff entstehen kann, für ihre Entstehung mehr Energie − als Konsequenz wird die Elektrolyse langsam und unwirtschaftlich. «Wir gehen davon aus, dass das nicht nur bei Kobalt, sondern auch bei anderen Metallen der Fall ist, die ebenfalls im Sauren weniger gut funktionieren – etwa bei Mangan, Eisen und Nickel», sagt Jinzhen Huang, Postdoktorand in der Forschungsgruppe von Emiliana Fabbri sowie Thomas Schmidt und Erstautor der Studie.
Kobalt als günstige Alternative
Als Katalysatoren für das Spalten von Wasser werden derzeit meist die Edelmetalle Iridium und Ruthenium eingesetzt. Sie ändern ihre Aktivität in Abhängigkeit vom pH-Wert nur wenig und funktionieren daher auch im sauren Milieu gut. Kobalt und andere sogenannte Übergangsmetalle sind jedoch deutlich günstiger und auf der Erde häufiger verfügbar, was sie gerade für grosstechnische Anwendungen attraktiv macht. «Die Edelmetalle durch Kobalt und andere günstigere Metalle zu ersetzen, ist eine grosse Herausforderung», erklärt Emiliana Fabbri. «Unsere Erkenntnisse sind wichtige Schritte auf dem Weg dahin.»
Die PSI-Forschenden haben die Sauerstoffbildung während der Elektrolyse mit unterschiedlichen Methoden eingehend untersucht. Unter anderem nutzten die Forschenden dafür das Röntgenlicht der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS. Als Katalysator setzten sie Kobaltoxid-Nanopartikel ein. Diese waren in die Anode eingearbeitet, also jenen Teil der Apparatur, an dem sich Sauerstoff bildet.
Die Oberfläche macht‘s
Wie die Messungen der PSI-Forschenden zeigen, bildet sich an der Oberfläche des Kobaltkatalysators eine Schicht aus Sauerstoff- und Wasserstoffverbindungen, die im Laufe der Elektrolyse dicker wird. An dieser neu entstandenen Oberfläche finden die Reaktionen im weiteren Verlauf der Elektrolyse dann statt. «In einer neutralen oder sauren Umgebung bauen sich diese katalytisch wirkenden Schichten entweder nur mit geringer Geschwindigkeit oder unter höherer Energiezufuhr auf», erklärt Jinzhen Huang. «Das ist der Grund, warum auch die Gesamtreaktion mehr Energie benötigt, um ablaufen zu können, und insgesamt schlichtweg langsamer ist als im Alkalischen.»
Mit ihrer Studie löst das Team um Emiliana Fabbri ein Rätsel, das die Wissenschaft schon des Längeren beschäftigt. Die Erkenntnisse können dabei helfen, den Vorgang der Elektrolyse besser zu verstehen und in Zukunft effizienter zu machen. So könnte ein anderes Design des Katalysators helfen, die Reaktion wirtschaftlicher zu machen.